Auf dem Sofa sitzen zwei bolivianische Austauschschülerinnen, löffeln Stracciatellajoghurt, albern herum und erstellen ein Ranking der wichtigsten Ausdrücke für Deutschland. Der Gewinner ist „alles gut!“ – die Universalfloskel des Jahres. „Alles gut“ ist wirklich unschlagbar praktisch. Sie ist leicht auszusprechen, sie besitzt weder Umlaute noch beginnt sie mit „H“, benötigt keine typisch deutsche Zisch- und Rachenlaute und ist somit akzentfrei zu lernen in unter drei Minuten. Fast alle Fragen lassen sich damit beantworten: Die Gastkinder finden es prima.
Ich als Gastmutter finde es doof, denn es erwürgt jede Unterhaltung. „Alles gut!“ klingt höflich und munter und spielt den Ball einfach wieder zurück in meine Spielfeldhälfte, ohne dass wirklich inhaltlich etwas ausgetauscht worden wäre. Ich fühle mich nicht wie ein Gesprächspartner, eher wie eine Herbergsmutter oder eine Hotel-Concierge. Von wegen alles gut!
Wo lernt man, wie man sich mit Menschen austauscht? Wann bekommt man Zuhören beigebracht, Gegenfragen? Nachhaken, wenn man unzufrieden mit einer Auskunft ist oder einem Ergebnis? Wie lernt man, ein Gespräch zu beginnen, nachdem man sich im Groll getrennt hat? Oder überhaupt: Reden, auch wenn man nichts gefragt wurde? Wenn man es von zu Hause nicht kennt, kann das Leben in einer anderen Familie ein guter Anlass sein, es zu lernen.
Erfahrene Austauschorganisationen kennen das und bauen allerlei kommunikative Brücken in die Abläufe ein. Der gemeinnützige Verein Schwaben international vermittelt seit zwanzig Jahren Kinder von Südamerika nach Europa und umgekehrt. Sowohl die individuelle Betreuung der Gasteltern als auch der Schüler sind für die Organisatoren unverhandelbare Bedingungen. „Wir rufen nach zwei Wochen bei allen Familien persönlich an und erkundigen uns, wie es läuft“, sagt Ingrid Bauz von der Geschäftsstelle. Dank ihrer langjährigen Erfahrung hören die drei festen Mitarbeiterinnen schnell heraus, woran unglückliche Konstellationen kranken. „Dabei helfen uns die muttersprachlichen Begleitlehrkräfte, die die ganze Zeit vor Ort sind“, sagt Bauz und zählt eine Reihe weiterer Maßnahmen für ein gutes Miteinander auf: Ein freundliches, mehrseitiges Elternbriefing, ein mehrtägiges Eingewöhnungscamp vor der Verteilung auf die Gastfamilien, permanent erreichbare, erfahrene Ansprechpartner in der Organisation.
Von all dem kann man nur träumen, wenn der Austausch alleine über eine Schule abgewickelt wird. Dabei können die Lehrer am wenigsten was dafür, sie sind schließlich keine Reisebüros oder Seelsorger. Die meisten engagieren sich freiwillig und ohne zusätzliche Bezahlung oder Ausbildung als Ansprechpartner und zeigen viel Einsatz für die Schüler. Für die Gastfamilien sind sie nicht zuständig.
„Setzen Sie sich zusammen und reden Sie miteinander, dadurch kann das meiste sehr leicht geklärt werden.“ So steht es lapidar auf den meisten Austausch-Plattformen und Anbieterseiten. Ich fürchte, das klingt einfacher, als Fünfzehnjährige tatsächlich sind. Ein Gespräch einfordern, seine Gefühle darstellen, lösungsorientiert diskutieren und das auch noch in einem interkulturellen Kontext! Besser ist da WhatsApp, denn es ist immer da, kostet nichts und verbindet einen direkt mit Menschen, die einen wirklich verstehen. Auch dieses Phänomen kennt Ingrid Bauz: „Bevor die Smartphones aufkamen, rief jeder Schüler einmal nach der Ankunft zu Hause an und dann nicht mehr. Das klappte viel besser als heute“. Paradoxerweise seien es häufig die Eltern der Kinder, die möchten, dass die Kinder permanent erreichbar sind. Diese Haltung schade den Kindern ganz enorm, so Bauz weiter, die Kinder würden zum einen daran gehindert, Deutsch zu sprechen und hätten keinen Anlass, sich auf die neue Kultur wirklich einzulassen.
Doch auch ohne viel Geld und personelle Ressourcen könnten Schulleitungen ihr eigenes Austauschkonzept verbessern. In Fachpublikationen und Netzveröffentlichungen machen sich eine Reihe von erfahrenen Pädagogen Gedanken darüber, wie interkulturelle Kommunikation gut funktionieren kann und welches die Stellschrauben dafür sein könnten.
Eine dieser Pädagogen ist Frau Dr. Gabriela Fellmann. Ein Vortrag von ihr auf einer Fachtagung des Pädagogischen Austauschdienstes, der einzigen staatlichen deutschen Einrichtung für den internationalen Austausch von Schülern, beschäftigt sich mit dem wunderbaren Begriff Begegnungsdidaktik. Dieser Begriff sagt, dass Fachleute ganz genau wissen, dass nichts von selbst läuft, wenn einer alleine auf eine Familie oder Schulklasse in einem fremden Land trifft. Dr. Fellmann zum Beispiel hintermauert diese Begegnungsdidaktik mit vier sehr greifbaren Bausteinen:
1. Im Vorfeld Worst-Case-Situationen benennen und üben
Situationen, vor denen man Respekt hat, können trainiert werden. Es ist vermeidbar, wenn im Falle eines verpassten Zuges die Vokabel fehlt oder man nicht weiß, ob man Polizisten duzen oder siezen soll. Wie sinnvoll diese Vorübung ist, kann ich selbst bestätigen. Mein „schlimmster Fall“ war eine Entbindung im Ausland und ich erinnere mich, tagelang geburtshilfliche Fachvokabeln gepaukt und Sätze für den Ernstfall geübt zu haben. Ich brauchte sie nicht, aber es hat mich lässiger gemacht. Natürlich benötigen 15jährige (hoffentlich!) andere Sätze für andere Notfälle. Wenn sie noch nirgendwo gesammelt sind, wäre Niemandsland ein guter Platz dafür.
2. Mentorensysteme
Ein Mentorensystem gehört für die meisten professionellen Austauschorganisationen zum Standard. Ehemalige Gasteltern oder Mitarbeiter nehmen die Kinder gleich zu Beginn an die Hand oder stehen zumindest im Notfall zum Ortstarif zur Verfügung.
Das Minimum sollte eine Liste muttersprachlicher Ärzte im Gastland sein. Viele Organisationen laden pro Bundesland zu Vorbereitungstreffen oder geselligen Wochenenden ein, um sich auszutauschen und Unternehmungen zu organisieren. Mentoren nehmen beiden Seiten viel Druck ab – besonders den Gasteltern, für die jedes Standardproblem neu und katastrophal wirkt und die häufig beruflich stark eingespannt sind.
3. Gemeinsame Aufgaben stellen,
Gemeinsame Aufgaben zu stellen finde ich eine pfiffige Art, Kommunikation herbei zu führen, die oft nicht von alleine läuft, wenn man im Wohnzimmer sitzt und verzweifelt nach einem Thema sucht. Das gemeinsame Ausfüllen der Berichtsmappe, ein Fotobericht oder eine Themen-Ralley ergeben hingegen einen sachbezogenen Anlass, miteinander zu sprechen ohne persönlich werden zu müssen. Klar, dass auch der Spracherwerb sehr davon profitiert, wenn Wortfelder und Themen außerhalb von Haus und Schule angewendet werden müssen.
4. Betreuung durch regelmäßige Treffen und Interviews.
Laufende Rückkopplung mit dem Lehrer oder der Austauschorganisation entlastet die Schüler von Verantwortung, es allein schaffen zu müssen. Sie bekommen den Blick auch dahin gerückt, ihren Aufenthalt als Entwicklung zu sehen, und nicht als Prüfung oder Aufgabe, die man entweder auf Anhieb schafft oder vergeigt und am besten verdrängt. Wie oben erwähnt ist es kein leichtes Ding, verfahrene Situationen, die zwangsläufig passieren, wieder aus eigener Kraft aufs Gleis zu setzen. Es benötigt allerdings einen pädagogischen Hebel, Ermutigung und Begleitung, um dem natürlich Fluchtreflex entgegenzuwirken, aufzugeben und sich in WhatsApp zu verkriechen.
Ein Konzept, das diese begegnungsdidaktischen Kniffe anbietet, dürfte keiner Schule größere Probleme bereiten. Notfallsätze aufschreiben, die Schüler ab und an anrufen und den obligatorischen Reisebericht in eine gemeinsame Aufgabe umwandeln sind eher eine Willens- als eine Ressourcenfrage. Sogar ein Mentorensystem sehe ich nicht als Unmöglichkeit. Gerade deutsche Auslandsschulen verfügen über ein enormes Netz ehemaliger Lehrkräfte in allen deutschen Bundesländern. Sie und ihre Familien helfen meist gerne weiter. Wenn sie gefragt werden.
Inzwischen geht mein persönlicher Schüleraustausch in die nächste Runde: Diesmal ist Frankreich zu Gast. Unsere französische Austauschschülerin kontrolliert ihren Schulranzen, nickt das eingepackte Pausenbrot ab und schaut mich fragend an „Gluck Gluck???!??“ Oh. Ich habe das Getränk vergessen! Ihre Eltern haben sie – als unter 16jährige – mit ein paar Flaschen Rotwein als Gastgeschenk über die Grenze geschickt, wofür sie in Deutschland ein Busgeld von 300 Euro hätten zahlen müssen. Es war ein sehr leckerer Wein und ein guter Gesprächsanlass für die deutschen Jugendschutzgesetze. Für die heutige Graffiti-Führung durch die weniger touristischen Viertel von Köln packe ich schnell daher lieber eine Wasserflasche ein: „Voilá GluckGluck!“ – „Alles gut!“.
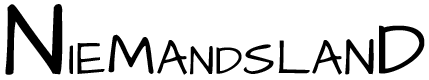

Kommentar verfassen