Von irgendetwas muss man leben, an irgendetwas muss man sterben…
Es war ein Sonntagmittag im Dezember und wir mussten mit 3 Stunden Fahrt rechnen, um pünktlich in Oruro einzutreffen und den Zug nehmen, der uns nach Villazón bringen würde, einem kleinen Örtchen an der Grenze zu Argentinien, wo der Service der bolivianischen Eisenbahn endete. Unser Bus hatte bereits die ersten 10 km seit dem Busterminal in La Paz zurückgelegt und ich war von der geringen Passagierzahl überrascht: Wir waren sieben in einem interregionalen Transportmittel, das für mehr als 50 Personen ausgelegt war. Wir waren kaum losgefahren, da hatten die übrigen Passagiere alle Hände voll zu tun mit dem Essen, das sie bei den Straßenverkäufern erstanden hatten, die am Busterminal eingestiegen waren und uns davon zu überzeugen versuchten, dass ihre Sandwichs mit Fleisch von „zarten und brustreichen Hühnern“ belegt waren; und der Fahrer, der von einem kleinen Jungen begleitet wurde, der auf dem Beifahrersitz saß, und einem weiteren Burschen, der noch nicht mal 15 war und als Kassierer fungierte, legte uns eine CD mit diesen fröhlichen Rhythmen der Cumbia Chicha und Villera auf, die von Liebe, Vergessen, Untreue, Schmerz und Bier erzählten.
Während der Bus die Asphaltschlucht hinauf fuhr und La Paz hinter sich ließ, dachte ich an den Busbesitzer und seine schlechte Investition. Fährt er wohl jeden Tag so leer? Warum glaubte man also, dass das Transportwesen eines der lukrativsten Branchen der informellen Wirtschaftaktivität dieses Landes wäre? Stimmt es etwa nicht, dass es der Traum der Aymara und Quechua ist, eines Tages ihre Ersparnisse in diesen Zweig zu investieren? Bei einem mit lediglich 7 Passagieren besetzten Bus, wo war da das Geschäft?
* * *
In weniger als einer halben Stunde erreichten wir El Alto, die Stadt mit dem größten demografischen Wachstum des Landes, Magnet der ländlichen Migration der peruanischen und bolivianischen Hochlandbevölkerung. Die mit 848.840 Einwohnern zweitgrößte Stadt, und eine der ärmsten Boliviens, auch wenn hier neben Gebäuden, deren Wert in den kommerziellen Vierteln auf über eine halbe Million USD geschätzt wird, ganz einfache Bauten stehen. Eine Stadt, in der es in vielen ihrer Randvierteln noch immer kein Trinkwasser gibt. Wenn man aus der Luft schaut, könnte El Alto als eine Stadt im Norden Afrikas durchgehen, wären da nicht die schneebedeckten Berge im Hintergrund und die vielen Kirchtürme, von denen viele das Werk von Pater Sebastián Obermaier sind, in El Alto als Tata Obermaier bekannt. Ein deutscher Priester, der sich seit vier Jahrzehnten der sozialen Arbeit widmet und Tempel baut – von diesen einige mit einem zwiebelförmigen Turm, der so typisch für den Süden Bayerns ist – in der höchsten andinen Polis mit der größten Bevölkerung der Anden. Tata Obermaier ist eine so einzigartige wie beliebte Persönlichkeit in seiner Adoptivstadt. In einer Anekdote heißt es, dass der Tata in nur wenigen Stunden sein Auto zurückbekam, das ihm vor einer seiner Kirchen gestohlen worden war, dank der Hilfe der Einwohner eines entlegenen Viertels, die den uralten Pickup erkannten, mit dem der in den Medien bekannte Priester normalerweise durch die Straßen kurvt. Eine treffende Nachbarschaftsaktion, vor allem wenn man an das Schicksal Hunderter gestohlener Fahrzeuge denkt, die nach Monaten und Jahren polizeilicher Nachforschungen nicht an ihre Eigentümer zurückgegeben werden können. Ein Beweis dafür, dass die Kriminalität in El Alto sehr hoch ist und sogar die Männer Gottes trifft, aber gleichzeitig auch ein Zeichen dafür, dass die Alteños (wie die Einwohner von El Alto heißen) ihren Wohltätern wohlgesonnen sind; sie sind sehr katholisch trotz der vielen andinen Glaubensrichtungen und Riten sowie der Verbreitung von Sekten; und sehr entschlossen, wenn es darauf ankommt.
* * *
Der Bus hielt an einer Ecke voller Leute, Bündel, Straßenverkäufer und Geschrei. Wir befanden uns über 4.000 Meter Höhe und die Menschen stiegen völlig ungeordnet und drängelnd ein; die Eile, einen Platz zu ergattern. In fünf Minuten war der Bus inklusive Gang voll. Sämtliche Bündel, die im Gang lagen, wurden zu Sitzgelegenheiten und Stützen für Frauen, die Kinder auf dem Rücken trugen oder für ein paar alte gekrümmte Frauen, die zu dösen begannen sobald sie sich an jemanden oder etwas an ihrer Seite anlehnen konnten. Die Musik war nicht mehr zu hören und man vernahm nur noch ein paar Sätze auf Aymara oder Spanisch zwischen denen, die zusammen reisten. Die Mehrzahl der Männer trug Jeans und Jacke während sämtliche Frauen ihre beste Sonntags- bzw. Ausgehkleidung trugen: mehr Röcke, den besten Hut und ihren auffälligsten Umhang. Es war offensichtlich, dass ein Großteil von ihnen in ihre Dörfer zurückkehrte, in jene kleinen bzw. winzigen Örtchen auf dem Weg nach Oruro, nachdem sie auf einem der Märkte in El Alto ihre Einkäufe getätigt hatten. Ich konnte den Geruch der Zwiebeln und des getrockneten Fleisches wahrnehmen, der aus den Taschen und Bündeln drang, die in dem engen Gang standen.
Wir fuhren los und durch die Fenster sahen wird, wie uns ein paar Touristen winkten, die im Nachbarbus saßen. Wir winkten eifrig zurück. Mir fiel eine Touristin im Nebenbus auf, die unsere eifrigen Gebärden nicht bemerkte: Sie war über ihrem e-reader in irgendeine Lektüre vertieft. Die Technologie ließ grüßen aus einem Bus voller Körbe, Bündel und anderem Kram, der mit dieser Modernität nicht zusammenpasst.
* * *
Der Nachmittag strahlte vor Sonne und die Temperatur im Bus heizte sich auf. Mit Mühe schafften wir es, eines der Fenster zu öffnen, um die kalte Luft von draußen reinzulassen und den Zwiebel- und Schweißgeruch, den wir in der Nase hatten, etwas zu mildern.
Wir kamen nur sehr langsam voran auf einer Straße, die geflutet war mit asiatischen „Minibusse“–Passagierlieferwagen, Fernbussen und vor allem LKWs, die mit Fracht und Passagieren dramatisch überladen waren. Mir fiel auf, dass ich nur Männer am Steuer sah: keine Frau, nicht einmal in einem Privatwagen.
Wir fuhren weiter, ohne das Stadtgebiet von El Alto zu verlassen, allerdings kamen wir jetzt schneller voran auf einer Straße, die von hohen, unverputzten Backsteinhäusern und anderen, niedrigeren und ärmlicher wirkenden Häusern gesäumt war, Wohnstätten aus Lehmziegeln und mit politischen Manifesten bekritzelte Wände. Ich ging davon aus, dass das wohl so sein musste: In Bolivien atmet man die Politik ein und die Mauern der armen Viertel schwitzen Parteilichkeit aus. Zu beiden Seiten der Landstraße fuhren Fahrräder, die es nicht unbedingt eilig hatten; fast alle waren überladen: Fahrer, Mitfahrer plus Wocheneinkauf.
An eine Ecke zeigte sich arrogant ein Cholet andino. Ein mehr als drei oder vierstöckiges Gebäude, in schrillen und kontrastreichen Farben gestrichen, gekrönt von einer Art Penthouse mit einem steil abfallenden Dach und vorstehenden Dachtraufen. Ich dachte nicht nur an den genialen Namen: die Verbindung des andinen Wortes Cholo mit dem schweizer Chalet, sondern auch an den kommerziellen und politischen Scharfsinn seines Erfinders und seiner Unterstützer. Seit seiner Zeit hat das Konzept nur gute Renditen eingebracht: viel Presse und gekonnt illustrierte Bücher mit Fotos, die von Texten unterstützt werden, die aus soziologischer Sicht versuchen, die architektonischen Marotten ihrer Besitzer zu erklären. Andiner Surrealismus für den Export in eine Welt, die verrückt nach seltenen und extravaganten Dingen ist. Gerade in diesen Tagen, an denen ich diese Geschichte schreibe, erzählte man mir, dass die in manchen Cholets untergebrachten Festsäle für umgerechnet 4.000 Euro pro Nacht vermietet werden, Musik nicht inbegriffen, und dass ihre Kunden die vermögenden Alteños sind. Die Cholets sind so attraktiv – sagte man mir – dass auch der k’ara der Zona Sur nicht fehlt (hellhäutig, Bourgeois, Imperialist und Unterdrücker, wie die politischen Alteños die Paceños dieses Teils der Stadt La Paz abschätzig nannten in der Zeit, in der es diskursiv und ideologisch heiß herging), der seinen Geburtstag in einem dieser einzigartigen Gebäude feiern möchte, um seinen Gästen eine exotische Erfahrung zu bescheren. Es stellt sich jedoch die Frage, ob das Geburtstagskind der Zona Sur den Tarif für das berühmte Lokal zahlen kann oder nicht.
* * *
 Langsam ließen wir den stockenden Verkehr hinter uns und die Landstraße wurde inmitten der Hochlandebene immer freier. Das war der Moment, als der Assistent des Busfahrers, der auch dabei geholfen hatte, die Bündel zu verstauen, sich seinen Weg durch den gerammelt vollen Gang bahnte und begann, bei den neu Zugestiegenen, d. h. bei fast allen, die Fahrtkosten zu kassieren. In diesem Moment wusste ich, dass der Eigentümer des Busses kein schlechtes Geschäft gemacht hatte: ein voller Bus und Tickets ohne Rechnung, ein doppelter Gewinn.
Langsam ließen wir den stockenden Verkehr hinter uns und die Landstraße wurde inmitten der Hochlandebene immer freier. Das war der Moment, als der Assistent des Busfahrers, der auch dabei geholfen hatte, die Bündel zu verstauen, sich seinen Weg durch den gerammelt vollen Gang bahnte und begann, bei den neu Zugestiegenen, d. h. bei fast allen, die Fahrtkosten zu kassieren. In diesem Moment wusste ich, dass der Eigentümer des Busses kein schlechtes Geschäft gemacht hatte: ein voller Bus und Tickets ohne Rechnung, ein doppelter Gewinn.
Wir fuhren Richtung Süden und es lagen etwa 220 Kilometer vor uns. Nach einer halben Stunde Ruhe und Schlummern (die Cumbias hörte man aufgrund der schlechten Lautsprecher kaum noch und die Reisenden dösten vor sich hin oder starrten auf die Rücklehne des Vordersitzes), wurde ein Handygespräch immer lauter. Es wurde fast geschrien:
– Ya pues hermanito, ich sag das jetzt noch einmal und zwar zum letzten Mal. Ich werde in einer Stunde da sein und dann wartest du gefälligst mit dem Geld auf mich. Andernfalls nehme ich das Vieh mit. Ja, ja, ich sag’s noch mal, am besten fängst du schon mal an, das Geld zu zählen…
Der Mann, der fast schrie, war mittleren Alters. Seine Haut war von der Sonne der Anden dunkel und gegerbt, und trotz der stickigen Luft im Bus hatte er einen Schal um den Hals. Er saß in der Reihe vor mir und wenige Minuten zuvor hatte er mich gebeten, ihm zu helfen, den Chip seines Handys zu installieren. Mir fiel sein Akzent auf, der von vibrierenden „r“, starken „s“ und von nach „sch“ klingenden „ll“ geprägt war. Mir war klar, dass es kein bolivianischer Aymara war. Er hatte wohl etwas an mir beobachtet, denn noch bevor er mich um den Gefallen bat und bevor ich überhaupt den Mund aufmachte, sagte er: Mi reina, sind Sie aus La Paz oder Touristin? Ich war überrascht und zugleich verwirrt. In dieser Region bezweckt der Ausdruck “mi reina” nichts anderes als zu erreichen, dass sich die “reina“ geschmeichelt fühlt und weniger wachsam ist, um dann den Anfragen und Bitten des „Untertanen“ nachzukommen. Was mich allerdings aus dem Konzept gebracht hatte war der Akzent und die Frage an sich. Ich fing mich jedoch wieder und nach nur zwei Minuten wusste er bereits, woher ich kam und ich wusste, wohin er fuhr und in welcher Angelegenheit: Er wollte sein Vieh zurück, das er vor einiger Zeit in einem der Dörfer untergebracht hatte, die an der Straße liegen, auf der wir fuhren. Ich installierte den Chip so gut ich konnte, hielt den Mund, und einige Sekunden später reklamierte er bei demjenigen, der am anderen Ende der Leitung war.
– Du hast wohl gedacht: diesen Peruaner werde ich verschlingen, aber so läuft das nicht, hermano. Mit mir macht man keine Spielchen. Ich bin wohl Peruaner, ich bin wohl aus den Bergen, aber ich halte, was ich sage. Und jetzt sage ich dir, hermano: Du bist ein toter Mann!
Die Stimme war so laut, dass alle Passagiere, die wir im hinteren Teil des Busses saßen, die Drohung mitbekommen hatten, allerdings erfuhren wir nie, welche Wirkung sie auf den vermeintlich schlechten Zahler hatte. Hat er wohl angefangen, das Geld zu zählen oder die Kühe?
Es war 18.00 Uhr und wir näherten uns Oruro, einer Stadt, die die Fortführung von El Alto zu sein schien, allerdings ohne Cholets, und 265.000 Einwohner zählt. Auf Oruro lastete der schlechte Ruf, die freieste Handelszone für den Schmuggel im ganzen Land zu sein. Entlastet wurde sie allerdings mit dem guten Ruf, die Hauptstadt des bolivianischen Exportkarnevals zu sein.
Der Bus fuhr noch als ich auf den Vordersitz schaute. Der Viehverkäufer war bereits irgendwo ausgestiegen und wir hatten es gar nicht bemerkt. Wie ist wohl seine Geschichte ausgegangen? Von irgendetwas muss man leben, an irgendetwas muss man sterben…?
Ja, das Leben in den andinen Städten und Straßen bringt diese Dinge mit sich.
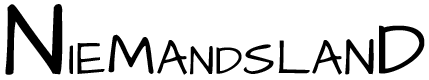

Kommentar verfassen